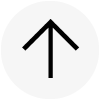Aktuelle „Informationen aus dem Versicherungsjournal“
Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat untersucht, wie normale Haushalte und Rentnerhaushalte von der Inflationswelle betroffen waren. Dies hat auch Auswirkungen auf die finanzielle Altersabsicherung.
Wie Rentner von der Inflation betroffen waren
10.6.2024 (verpd) || Das Kölner Institut der Deutschen Wirtschaft hat untersucht, ob Rentnerhaushalte von der Inflationswelle im Jahr 2022 besonders betroffen waren. Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass sowohl die normalen Haushalte als auch die von gesetzlich Rentenversicherten an Kaufkraft verloren haben. Die sollte bei der Altersvorsorge unbedingt berücksichtigt werden.
Das Kölner Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) hat im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung Bund untersucht, ob die Personen, die eine Rente von der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) erhalten, anders von der Inflation betroffen gewesen sind als andere Personen.
Die IW-Wissenschaftler betrachteten dazu neben den Haushalten mit GRV-Rentnern auch Arbeitnehmerhaushalte. Das Fazit der Wissenschaftler überrascht: „Seit 2018 sank die Kaufkraft der GRV-Rentner um 1,7 Prozent, bei anderen Haushalten ging sie um 2,2 Prozent zurück“, wie bei IW zu lesen ist.
Höheren Teil des Einkommens für Konsum ausgegeben
Da dem Wissenschaftsteam nur wenige aktuelle Daten zur Verfügung standen, musste man sich mit Fortschreibungen aus dem Jahr 2018 behelfen. So wurden etwa die monatlichen Ausgaben für 168 Konsumgüter in Preisreihen fortgeschrieben und unterstellt, dass die Verbraucher trotz des Inflationsdrucks ihr Konsumverhalten nicht geändert haben.
Im Ergebnis kamen die Wissenschaftler Dr. Martin Stockhausen und Dr. Martin Beznoska unter anderem zu dem Schluss, dass GRV-Rentnerhaushalte im Durchschnitt einen höheren Teil ihres Einkommens für Konsum ausgeben.
Hohe Inflation in den letzten beiden Jahren
Für die GRV-Rentner und die sonstigen Haushalte (vor allem Arbeitnehmer) betrug der Preisauftrieb im Jahr 2022 jeweils 8,1 Prozent. Dabei werden Rentnerhaushalte etwa durch hohe Energiepreise belastet, während Arbeitnehmer mehr für Verkehr (den Weg zur Arbeit) bezahlen müssen. Zum Vergleich: Die gesetzliche Anpassung der Renten (Rentenanpassung) betrug im gleichen Jahr nur 5,35 Prozent in West- und 6,12 Prozent in Ostdeutschland.
Im Jahr 2023 kamen die GRV-Rentner auf eine Inflationsrate von 5,8 und die sonstigen Haushalte auf 5,7 Prozent. Die genannte Inflationsrate entspricht der Teuerung innerhalb eines Jahres für Warengruppen wie Nahrung, Energie, Freizeit, Unterhaltung und Kultur, Gesundheit, Verkehr, Miete und sonstiges. Auch hier war in Westdeutschland die Rentenanpassung mit 4,39 Prozent deutlich niedriger. In Ostdeutschland lag sie bei 5,86 Prozent.
Die passende Höhe der Altersvorsorge
Bei der Festlegung einer bedarfsgerechten Höhe der Altersvorsorge gilt es, zum einen zu berücksichtigen, dass die gesetzliche Altersrente nicht einmal der Hälfte des bisherigen Einkommens entsprechen wird, da das Rentenniveau bereits jetzt bei nur 48 Prozent liegt.
Zum anderen reichen die Rentenanpassungen der gesetzlichen Altersrente oftmals nicht, um den Kaufkraftverlust, der durch die Inflation gegeben ist, auszugleichen, wie die IW-Studie belegt.
Daher ist es nicht nur wichtig, die Lücke zwischen der bisherigen Einkommens- und der künftigen Rentenhöhe zu schließen, sondern auch die Wertminderung der Alterseinkünfte infolge der Inflation abzusichern. Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass auch die Ausgaben zum Beispiel für den Lebensunterhalt wie Nahrungsmittel und Wohnkosten steigen werden.
In einem ausführlichen Beratungsgespräch kann ein Versicherungsfachmann die hierzu notwendigen Analysen und Berechnungen erstellen und individuell passende Absicherungslösungen anbieten.
Quelle: VersicherungsJournal Verlag GmbH • Rathausstr. 15 • 22926 Ahrensburg • Deutschland Telefon +49 (0)4102 7777880 • E-Mail kontakt@versicherungsjournal.de • www.versicherungsjournal.de Geschäftsführer Claus-Peter Meyer • Handelsregister Ahrensburg HRB 4295 • USt-ID DE207950892
Im Zuge der Anpassung der gesetzlichen Renten zum 1. Juli 2024 dürfen Bezieher einer Hinterbliebenenrente mehr als bisher dazu verdienen, ohne dass es zu Rentenabzügen kommt.
Witwen-/Witwerrente: Höherer Hinzuverdienstfreibetrag
21.5.2024 (verpd) || Aufgrund der positiven Lohnentwicklung werden die gesetzlichen Rentenbezüge zum 1. Juli 2024 um 4,57 Prozent steigen. Wer eine Witwen-, Witwer- oder Erziehungsrente bekommt, darf zudem mehr als bisher dazuverdienen, ohne dass er mit Rentenabzügen rechnen muss.
Aufgrund der jährlichen Rentenanpassung, die nach einer festen Anpassungsformel erfolgt, welche auch die Lohnentwicklung des vorherigen Jahres berücksichtigt, steigen die gesetzlichen Alters-, Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenrenten zum 1. Juli 2024 bundesweit um 4,57 Prozent.
Zeitgleich erhöht sich der Freibetrag für den Hinzuverdienst, den Bezieher einer gesetzlichen gesetzliche Witwen-, Witwer- oder Erziehungsrente maximal haben dürfen, ohne dass es Rentenabzügen kommt.
Höherer Freibetrag ab 1. Juli 2024
Konkret steigt durch die Rentenanpassung zum 1. Juli 2024 der aktuelle Rentenwert von bisher 37,60 Euro auf dann 39,32 Euro. Der Freibetrag für den Hinzuverdienst der genannten Hinterbliebenenrente errechnet sich aus dem 26,4-Fachen des aktuellen Rentenwertes. Hat ein Bezieher einer Hinterbliebenenrente noch Kinder, die eine gesetzliche Waisenrente erhalten, erhöht sich der Freibetrag zudem um das 5,6-Fache des Rentenwertes je Kind.
Demnach liegt der monatliche Freibetrag vom 1. Juli 2023 bis einschließlich 30. Juni 2024 in ganz Deutschland bei 992,64 Euro. Ab dem 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025 dürfen aufgrund der Rentenanpassung Bezieher einer gesetzliche Witwen-, Witwer- oder Erziehungsrente im Monat bis zu 1.038,05 Euro hinzuverdienen, damit die Rente abzugsfrei bleibt.
Erzieht der Rentenbezieher ein oder mehrere Kinder, welche eine gesetzliche Waisenrente erhalten, erhöht sich die Hinzuverdienstgrenze je Kind ab dem 1. Juli 2024 von 210,56 Euro auf 220,19 Euro. Übrigens: Alle minderjährigen und auch volljährigen Kinder, die Anspruch auf eine gesetzliche Waisenrente haben, können seit 2015 unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass dies zu Rentenabzügen bei ihnen führt.
Beratungsangebot nutzen
Um Nachteile zu vermeiden, kann sich jeder Bezieher einer gesetzlichen Witwen-, Witwer- oder Erziehungsrente, der etwas dazuverdienen will oder muss, vorher bei der zuständigen Beratungsstelle der gesetzlichen Rentenversicherung informieren, mit welchen Abzügen er konkret rechnen muss.
Denn die Berechnung, ob und in welcher Höhe ein Rentenabzug tatsächlich erfolgt, ist kompliziert. Je nach Einkommensart wird zum Beispiel nur ein bestimmter prozentualer Anteil bei der Ermittlung des Nettoeinkommens und des möglichen Rentenabzuges angerechnet. Zudem werden nicht alle Einkunftsarten bei der Berechnung der Rentenabzüge berücksichtigt.
Einzelheiten dazu enthält die kostenlos downloadbare Broschüre „Hinterbliebenenrente: Hilfe in schweren Zeiten“ des DRV.
Einkunftsarten, die zum Rentenabzug führen können
Zu den anrechenbaren Einkunftsarten, die zu Rentenabzügen führen können, zählen nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung (DRV):
- „Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit,
- Erwerbsersatzeinkommen wie Arbeitslosengeld I, Krankengeld oder Renten der gesetzlichen Rentenversicherung,
- Zinseinkünfte aus eigenem Vermögen,
- Gewinne aus Verkäufen,
- Miet- und Pachteinnahmen,
- Betriebsrenten,
- Renten aus privaten Lebens-, Renten- oder Unfallversicherungen,
- Elterngeld,
- vergleichbare ausländische Einkommen.“
Einkommensarten, die keine Rentenkürzung zur Folge haben
Doch nicht jede Einkommensart wird angerechnet. Zu keiner Kürzung der Hinterbliebenenrente kommt es unter anderem bei Einkünften aus einer staatlich geförderten Altersvorsorge wie einer Riester- oder Rürup-Rente. Das gleiche gilt für ein Pflegegeld der gesetzlichen Pflegeversicherung, welches eine Person für die Pflege eines Pflegebedürftigen erhält.
Zu keinem Abzug führt in der Regel auch eine geringfügige rentenversicherungsfreie Beschäftigung oder eine geringfügige Beschäftigung, bei der man sich von der Rentenversicherungspflicht befreien hat lassen, wie dies beim 538-Euro-Minijob möglich ist.
Auch bedarfsorientierte Leistungen wie Bürgergeld (vormals Arbeitslosengeld II), Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung, Wohngeld, sonstige Sozialhilfe sowie Leistungen nach dem Bundesausbildungs-Förderungsgesetz (BAföG) zählen nicht als anrechenbares Einkommen.
Allerdings: Die Hinterbliebenenrente wird zwar nicht durch einen Bezug von Bürgergeld oder Grundsicherung gekürzt, jedoch kann sich die Höhe des Bürgergeldes oder der Grundsicherung durch die Hinterbliebenenrente verringern.
Wie die Rentenabzüge ermittelt werden
Für die Einkommensanrechnung wird von den anrechenbaren Bruttoeinkünften je nach Einkunftsart ein pauschaler Anteil abgezogen, um die maßgeblichen Nettoeinkünfte zu ermitteln. Zur Ermittlung der anrechenbaren Nettoeinkünfte werden beispielsweise vom Bruttoarbeitseinkommen eines Arbeitnehmers 40 Prozent, bei Beamtenbezügen 27,5 Prozent und bei Arbeitseinkommen aus selbständiger Tätigkeit laut DRV 39,8 Prozent abgezogen.
Bei Bruttoeinnahmen aus Kapitalvermögen oder auch Vermietungen nach Abzug der Werbungskosten sind es 25 Prozent und bei gesetzlichen Alters- oder Erwerbsminderungsrenten pauschal 14 Prozent. Sind die so ermittelten Nettoeinkünfte insgesamt höher als die Hinzuverdienstgrenze, werden 40 Prozent des Differenzbetrages (ermittelte Nettoeinkünfte minus Hinzuverdienstgrenze = Differenzbetrag) von der Hinterbliebenenrente abgezogen.
Beispiel: Eine Witwe hat eine gesetzliche Witwenrente von 800 Euro. Ihr Bruttoarbeitsverdienst als Angestellte liegt bei 3.000 Euro. Die ermittelten anrechenbaren Nettoeinkünfte liegen somit bei 1.800 Euro (3.000 Euro minus 40 Prozent).
Damit liegt ihr anrechenbares Einkommen ab dem 1. Juli 2024 761,95 Euro über dem Freibetrag (1.800 Euro minus 1,038,05 Euro Freibetrag). Es werden der Witwe somit 304,78 Euro (40 Prozent von 761,95 Euro) von ihrer gesetzlichen Witwenrente abgezogen. Das heißt, die Rentenhöhe pro Monat liegt im genannten Beispiel nach Abzug des Hinzuverdienstes bei 495,22 Euro – das sind monatlich 18,16 Euro mehr als vor dem 1. Juli 2024.
Quelle: VersicherungsJournal Verlag GmbH • Rathausstr. 15 • 22926 Ahrensburg • Deutschland Telefon +49 (0)4102 7777880 • E-Mail kontakt@versicherungsjournal.de • www.versicherungsjournal.de Geschäftsführer Claus-Peter Meyer • Handelsregister Ahrensburg HRB 4295 • USt-ID DE207950892
Frauen erhalten im Schnitt ein deutlich niedrigeres Gehalt als Männer. Bei den Einkünften im Rentenalter ist der geschlechterspezifische Unterschied sogar noch größer, wie Daten des Statistischen Bundesamtes belegen.
Keine Gleichberechtigung beim Alterseinkommen
21.5.2024 (verpd) || Dass es selbst im Rentenalter keine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gibt, zeigt ein Blick auf die durchschnittlichen Alterseinkünfte der ab 65-Jährigen. Laut des Statistischen Bundesamtes hatten Frauen im Rentenalter im Durchschnitt ein um mehr als ein Viertel niedrigeres Einkommen als Männer derselben Altersklasse. Dies zeigt sich auch bei der Altersarmut.
Vor Kurzem hat das Statistische Bundesamt (Destatis) erste Ergebnisse einer regelmäßigen Erhebung bezüglich Einkommen, Armut und Lebensbedingungen der Bürger in der Europäischen Union (EU) veröffentlicht. Diese EU-Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen, kurz EU-Silc (European Community Statistics on Income and Living Conditions), basiert auf einer jährlichen Umfrage.
Letztes Jahr wurden dazu allein in Deutschland über 61.000 Einwohner in über 35.400 Haushalten befragt. Die Fragen zum Einkommen bezogen sich laut Destatis auf das Vorjahr der Erhebung, also auf 2022. Die Befragung zeigt, dass nicht nur der Stundenlohn, sondern auch die Alterseinkünfte von Frauen im Vergleich zu Männern deutlich niedriger sind.
Die Höhe des geschlechterspezifischen relativen Verdienstunterschieds wird durch den sogenannten Gender Pay Gap und bei ab 65-Jährige durch den Gender Pension Gap angegeben.
Hoher Verdienstunterschied im Rentenalter
Laut EU-Silc 2023 hatten Frauen im Vergleich zu Männern im Durchschnitt einen um 18 Prozent (unbereinigter Gender Pay Gap) niedrigeren Stundenlohn. Selbst bei einem bereinigten Gender Pay Gap, also wenn man den Arbeitsverdienst von Beschäftigten mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien gegenüberstellt, verdienten Frauen im Schnitt sechs Prozent weniger pro Stunde als Männer.
Deutlich höher ist der Gender Pension Gap – auch geschlechtsspezifische Altersvorsorgelücke oder Rentenlücke genannt. Dieser Wert gibt den relativen Unterschied des durchschnittlichen Alterssicherungseinkommens von Männern und Frauen im Alter ab 65 Jahren an.
Die Höhe der Alterseinkünfte der ab 65-jährigen Frauen war laut EU-Silc im Schnitt um 27,1 Prozent niedriger als die der Männer der gleichen Altersklasse. Zu den Alterseinkünften zählen laut Destatis Alters- sowie Hinterbliebenenrenten und -pensionen, aber auch Renten aus individueller privater Vorsorge.
Im Detail hatten Frauen im Seniorenalter im Jahr 2022 ein durchschnittliches Alterseinkommen in Höhe von 18.663 Euro brutto im Jahr, bei den Männern ab 65 Jahren waren es dagegen 25.599 Euro.
Viele Frauen sind auf Hinterbliebenenrente angewiesen
Die Ursachen für den deutlichen geschlechterspezifischen Unterschied bei den Alterseinkünften sind laut Destatis vielfältig: „So erwerben Frauen im Laufe ihres Erwerbslebens im Schnitt geringere Rentenansprüche, weil sie teilweise in schlechter bezahlten Branchen arbeiten als Männer. Frauen arbeiten zudem häufiger in Teilzeit, nehmen häufiger und längere Auszeiten für Care-Arbeit und sind seltener in Führungspositionen tätig.“
Zu den Care-Arbeiten zählen beispielsweise die Pflege von Angehörigen oder die Erziehung von Kindern. Bei den ab 65-jährigen Frauen erhielten etwa 29 Prozent eine Hinterbliebenenrente, die sich aus den Rentenansprüchen des verstorbenen Ehepartners ableiten. Bei den Männern der gleichen Altersklasse bezogen nur sechs Prozent eine solche Witwerrente.
Berücksichtigt man die abgeleiteten Rentenansprüche, die von der Erwerbstätigkeit des Ehepartners abhängen, beim Einkommensvergleich zwischen Männer und Frauen nicht, war der letzte ermittelte Gender Pension Gap mit 39,4 Prozent sogar deutlich noch höher.
Das heißt, im Rentenalter hatten Frauen ohne die Hinterbliebenenrente gerechnet ein um 39,4 Prozent niedrigeres Alterseinkommen als Männer. Die Alterseinkünfte der Seniorinnen ohne Witwenrente lag im Schnitt bei 15.291 Euro, die der Senioren ohne Witwerrente dagegen bei 25.248 Euro.
Armutsgefährdung im Alter betrifft besonders Frauen
Die Daten lassen es bereits vermuten: Aufgrund des niedrigen Alterseinkommens sind anteilig deutlich mehr Frauen im Rentenalter von Armut gefährdet als Männer. Konkret lagen laut EU-Silc 2023 die Alterseinkünfte bei 20,8 Prozent der Frauen ab 65 Jahren unter der Armutsgefährdungsschwelle. Das heißt, ihr Einkommen war so niedrig, dass sie als arm galten oder von Armut gefährdet waren.
Bei den Männern der gleichen Altersklasse traf dies „nur“ auf 15,9 Prozent zu. Von allen ab 65-Jährigen waren aufgrund ihres niedrigen Einkommens 18,7 Prozent von Armut gefährdet. Laut Destatis gilt eine Person „nach der EU-Definition für EU-SILC als armutsgefährdet, wenn sie über weniger als 60 Prozent des mittleren Äquivalenzeinkommens der Gesamtbevölkerung verfügt.“
„2023 lag der Schwellenwert für eine alleinlebende Person in Deutschland bei 15.715 Euro netto im Jahr (1.310 Euro netto im Monat)“, so Destatis. Ein Jahr zuvor betrug die Armutsgefährdungsschwelle für einen Singlehaushalt noch 14.955 Euro (1.246 Euro netto im Monat).
Zur Berechnung der Armutsgefährdungsquote wird nach Destatis-Angaben „das von allen Haushaltsmitgliedern tatsächlich erzielte Haushaltseinkommen des Vorjahres herangezogen und nach einem Gewichtungsschlüssel (Äquivalenzskala) auf die Personen des Haushalts verteilt.“
Frühzeitige Einkommenssicherung
Die Destatis-Daten verdeutlichen, wie wichtig für Männer, aber insbesondere auch für Frauen eine ausreichende Hinterbliebenen-, aber auch eine individuell passende private Altersvorsorge ist, um nicht im Rentenalter in die Armutsfalle zu geraten.
So ist zum Beispiel eine zusätzliche Altersvorsorge über eine betriebliche und/oder private Anlageform, für die es zum Teil auch staatliche Unterstützung in Form von Zulagen und Steuererleichterungen gibt, möglich.
Für eine bedarfsgerechte Absicherung empfiehlt sich eine Beratung bei einem Versicherungsexperten. Dieser kann unter anderem berechnen, welches Alterseinkommen, also die gesetzliche Rente und sonstige Einkommen, im Alter zur Verfügung steht.
Bestehen Lücken im Vergleich zum benötigten oder gewünschten Einkommen, hilft der Versicherungsexperte auch bei der Auswahl der individuell passenden Vorsorgeformen.
Quelle: VersicherungsJournal Verlag GmbH • Rathausstr. 15 • 22926 Ahrensburg • Deutschland Telefon +49 (0)4102 7777880 • E-Mail kontakt@versicherungsjournal.de • www.versicherungsjournal.de Geschäftsführer Claus-Peter Meyer • Handelsregister Ahrensburg HRB 4295 • USt-ID DE207950892
Gesetzlich Krankenversicherte können als Krankenhauspatienten oftmals verschiedene Wahlleistungen wie eine Unterbringung in einem Ein- oder Zweibettzimmer in Anspruch nehmen. Allerdings sind die Kosten dafür ohne eine passende private Versicherungslösung hoch.
Optimierter Kostenschutz als Krankenhauspatient
3.6.2024 (verpd) || Es gibt zahlreiche Gründe, warum ein stationärer Aufenthalt in einem Krankenhaus notwendig werden kann. Gesetzlich Krankenversicherte haben aufgrund gesetzlicher Regelungen nur eine eingeschränkte Entscheidungsfreiheit bei der Wahl der Klinik, des behandelnden Arztes sowie der Art der Unterbringung und Behandlung. Wer mehr Auswahlmöglichkeiten haben möchte, muss ohne einen passenden privaten Versicherungsschutz mit erheblichen Mehrkosten rechnen.
Der Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben des Fünften Sozialgesetzbuches und muss medizinisch zweckmäßig, ausreichend und wirtschaftlich sein. Dies gilt auch für eine stationäre Unterbringung und Behandlung im Krankenhaus.
Einschränkungen bei der Krankenhauswahl …
So können gesetzlich Krankenversicherte beispielsweise nur in einem gewissen Umfang entscheiden, in welches Krankenhaus sie gehen, denn die Kosten für einen stationären Aufenthalt werden nur in einer GKV-Vertragsklinik von der Krankenkasse als Träger der GKV übernommen.
Die (Mehr-)Kosten, die für eine Behandlung und Unterbringung in einer Privatklinik aufzuwenden sind, zahlt die GKV in der Regel nicht. Wer sich dennoch in einer Privatklinik behandeln lassen möchte, muss daher mit deutlichen Zusatzkosten rechnen, die er selbst zu tragen hat.
… und der Unterbringungs- und Behandlungsart
Doch auch bei einem stationären Aufenthalt in einer GKV-Vertragsklinik wird nicht jede Unterbringungsart und Arztbehandlung von der GKV übernommen. So trägt die GKV üblicherweise nur die Kosten für eine Unterbringung in einem Mehrbettzimmer und die Behandlung durch den jeweils diensthabenden Arzt.
Zwar bieten die Kliniken diesbezüglich entsprechende Wahlleistungen an, wie die Unterbringung in einem Einbettzimmer, doch die Zusatzkosten, die der Patient dafür zu zahlen hat, sind nicht unerheblich.
Kostenschutz für mehr Wahlfreiheit
Die private Versicherungswirtschaft bietet jedoch Lösungen an, damit auch gesetzlich Krankenversicherte ohne Kostenrisiko mehr Wahlmöglichkeiten bei einem Krankenhausaufenthalt haben. Eine bestehende private Krankenzusatzversicherung übernimmt beispielsweise je nach Vertragsvereinbarung die anfallenden Mehrkosten für den stationären Aufenthalt in einer Privatklinik.
Auch die Zusatzkosten für eine Unterbringung im Ein- oder Zweibett- statt im Mehrbettzimmer und/oder die Mehrausgaben für eine Chefarztbehandlung oder für einen anderen Spezialisten können mit einer solchen Police abgedeckt werden.
Eine weitere Form der Krankenzusatzversicherung ist die private Krankenhaustagegeldversicherung. Ein Versicherter erhält von einer solchen Police für jeden Tag, den er als Patient stationär in einer Klinik verbringt, einen vertraglich vereinbarten festen Geldbetrag zur freien Verfügung ausbezahlt.
Damit kann er beispielsweise die Zusatzkosten, die bei einem Klinikaufenthalt anfallen, begleichen. So muss zum Beispiel jeder erwachsene Patient in der Regel für maximal 28 Tage pro Kalenderjahr für jeden Tag, an dem er im Krankenhaus stationär behandelt wird, zehn Euro Eigenanteil zahlen. Grundsätzlich ist es ratsam, eine Krankenhauszusatzversicherung bereits in jungen Jahren abzuschließen, denn je jünger und gesünder der Versicherte, desto niedriger ist die Prämie.
Quelle: VersicherungsJournal Verlag GmbH • Rathausstr. 15 • 22926 Ahrensburg • Deutschland Telefon +49 (0)4102 7777880 • E-Mail kontakt@versicherungsjournal.de • www.versicherungsjournal.de Geschäftsführer Claus-Peter Meyer • Handelsregister Ahrensburg HRB 4295 • USt-ID DE207950892